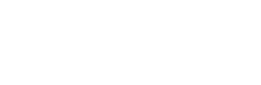In der Schweiz erfolgt mehr als die Hälfte der Haftantritte wegen nicht bezahlter Bussen oder Geldstrafen. Betroffen sind vor allem Mittellose.
Tausende landen jedes Jahr wegen Bagatellen im Knast. Neue Gefängniscontainer sollen im Kanton Bern helfen, kurze Haftstrafen zu vollziehen.
Zwei Tage musste Nici (38) im Januar im Regionalgefängnis Bern absitzen. Ihr Vergehen: eine Busse über 200 Franken wegen Schwarzfahrens, die sie nicht bezahlen konnte. «Ich bin eine routinierte Schwarzfahrerin», sagt Nici, die ihren vollen Namen nicht in der Zeitung lesen will.
Die Bernerin lebte bis vor kurzem auf der Gasse und ist von der Sozialhilfe abhängig. Die teuren Bustickets könne sie sich nicht leisten, sagt sie. Und landete deshalb im Knast. «Die Nacht geht, aber die Tage dauern ewig, da gehst du fast drauf.»
Wie Nici ergeht es jedes Jahr Tausenden. 8’540 Personen wurden 2022 in den Schweizer Straf- und Massnahmenvollzug eingewiesen. 4’472 mussten hinter Gitter, weil sie eine Geldstrafe oder Busse nicht bezahlen konnten. Mehr als jeder zweite Haftantritt erfolgte 2022 also wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe.
Die meisten Betroffenen bleiben zwar wie Nici nur wenige Tage im Bau. Doch die Belastung für Gefängnisse und Staatskasse ist gross. Besonders zu spüren bekommt das derzeit der Kanton Bern. Die Gefängnisse sind seit Monaten ausgelastet oder überbelegt. 120 der insgesamt gut 900 Zellen werden durchgehend für den Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafen gebraucht. Doch das reicht nicht: Wegen einer IT-Panne stapeln sich in Bern nicht bezahlte Bussen und Geldstrafen, die zu verjähren drohen.
Der Kanton Bern will deshalb mit Gefängniscontainern 40 zusätzliche Haftplätze für den Vollzug von Kurzstrafen schaffen. Kostenpunkt: 5,5 Millionen. Nächste Woche entscheidet das Kantonsparlament über den Kredit.
Jonas Weber (55), Strafrechtsprofessor an der Universität Bern, kritisiert die Pläne als «unverhältnismässig». Die Investition stehe in keinem Verhältnis zum geringen Verschulden, das den Ersatzfreiheitsstrafen zugrunde liege, sagt er. Weber plädiert stattdessen dafür, die Strafen bewusst verjähren zu lassen.
Eine Forderung, die bei der Berner Sicherheitsdirektion von Philippe Müller (61) nicht gut ankommt. Die Kantone seien gesetzlich verpflichtet, alle Strafen zu vollziehen, schreibt sie auf Anfrage, was Bern auch tun werde.
Müller hatte bereits bei der Präsentation der Containerlösung gewarnt, dass ein bewusstes Verjährenlassen ein fatales Präjudiz wäre. «Mit Verweis auf diese Fälle würde niemand mehr eine Geschwindigkeitsbusse bezahlen», sagte der FDP-Mann gegenüber der «Berner Zeitung». Ein Argument, das für Strafrechtsexperte Weber am Kern des Problems vorbeizielt. Betroffen seien meistens nicht renitente Bussenverweigerer, sondern Personen in finanziell prekären Situationen, die ihre Strafe nicht begleichen könnten. «Mit Ersatzfreiheitsstrafen wird erfolglos versucht, Armutskriminalität zu bekämpfen.»
Der Gesetzgeber sollte künftig unterscheiden zwischen Personen, die nicht bezahlen können und solchen, die nicht bezahlen wollen, fordert Weber. «Haft ist bei kleinen Bussen für Bagatellen wie geringfügige Vergehen im Strassenverkehr oder Urinieren am Bahnhof nicht angebracht. Der Staat müsste sich hier mehr zurücknehmen.»
Dass Ersatzfreiheitsstrafen die Schwachen trifft, ist dem System geschuldet: Dem Vollzug einer Busse oder Geldstrafe im Gefängnis gehen Mahnungen und ein Betreibungsverfahren voraus. Erst, wenn der geschuldete Betrag nicht einzubringen ist, kann Haft angeordnet werden.